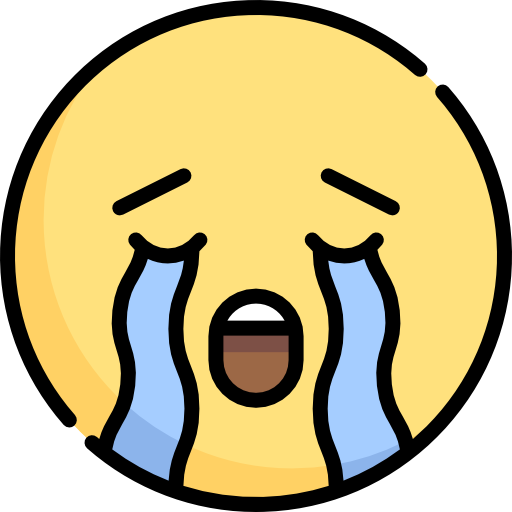-
Gesamte Inhalte
5 -
Benutzer seit
-
Letzter Besuch
-
Eine Geschichte über eine bekannte Frau im Museum
1
Ulrich Pätzold
DIE SCHÖNHEIT DER NOFRETETE
I.
Lächelt sie noch? Schaut sie in die Ferne des großen Reiches oder gehören der Blick der unendlichen Zeit des absichtslosen Daseins? Sie erklärt sich nicht von alleine. Ihre Schönheit leuchtet in warmen Farben und vornehmen Formen, ist gegenwärtig, jenseits von Zeit und Mode, geheimnisvoll schwebend.
Nein, sie lächelt eigentlich nicht. Ihre Lippen sind hart geschnitten modelliert. Das Gesicht zeigt sogar kleine Falten in der Haut unter den Augen. Das Rätsel der Schönheit teilt die Nofretete in Berlin mit der Mona Lisa in Paris. Wenn es denn ein Lächeln gibt, ist es das Lächeln der Schönheit als wahre Königin. Das zieht an und fordert Distanz. Es lässt Nähe zu, macht sich aber nicht mit dem Geschmack des einzelnen Betrachters gemein. In der Distanz aus Nähe strahlt die Macht der Königin Nofretete.
Für die Berliner Museumsinsel gilt der Grundsatz: Raumgestaltung und Kunstwerke bilden eine Einheit, und diese Einheit schafft wieder ein Kunstwerk.
Besonderen Ehrgeiz verbanden die Archäologen mit der 1898 gegründeten Deutschen Orient-Gesellschaft. Engländer und Franzosen hatten bereits ihren großen Musen spektakuläre Ausgrabungsfunde aus Ägypten und Mesopotamien einverleibt, und das Publikum strömte in Vorträge und Ausstellungen, in denen aus fernen Ländern und alten Zeiten anschaulich berichtet wurde, vielen nur aus der Bibel bekannt. Auch der Kaiser in Deutschland war begeistert und wollte seine Weltgeltung durch eigene Ausgrabungen glänzen lassen. Dazu fand er den genialen Mäzen, den Kunstliebhaber und Textilhändler James Simon. Simon scharte in der Orient-Gesellschaft Bankiers, Unternehmer und andere reiche Patrioten um sich und investierte vor allem sehr viel eigenes Geld. Großartige Funde kamen nach Berlin, die Prozessionsstraße und das Ischtartor aus Babylon , der Altar aus Pergamon.
1902 begannen die Grabungen des Teams um Ludwig Borchardt in Ägypten und verschlangen nie gekannte Summen Geld, 1911 fand Borchardt die Wüstenhügel, unter
denen die Schätze von Amarna verborgen waren. Eine wunderbare Welt der Kunst öffnete sich. In der 18.Dynastie der ägyptischen Reichsrechnung hatten hier der Pharao Echnaton und seine Frau Nofretete ihre Hauptstadt aufgebaut.
Die Grabungen mussten abgebrochen werden, als der 1. Weltkrieg ausbrach. Da waren bereits Züge voller Schätze aus dem Tell-el-Armana nach Berlin gerollt. Sie schmückten lange Jahre nicht die Museen, sondern lagerten, gut beaufsichtigt von James Simon, in den Depots oder sogar in den Wohnzimmern der Mitglieder der Orient-Gesellschaft.
Man weiß über Nofretete immer noch sehr wenig und wusste vor ihrer Bergung als Kunstwerk fast gar nichts über sie. Im Neuen Museum hat sie jetzt ihr Heiligtum gefunden. Es gibt neben dieser majestätischen Büste aber noch zahlreiche weitere Funde aus Amarna, die in Beziehung zu dieser Frau stehen und über sie berichten.
Die Königin war 1,58 Meter groß und zierlich. Sie hatte einen markanten langen Hals, der aus
2
den kräftigen Jochbeinen ihrer zarten Schultern wuchs. Sie hatte mandelförmige Augen, und ihre Ohren waren ziemlich klein. Ihre Lippen waren voll und elegant über dem weich gegliederten Kinn geschwungen. Ägyptisch gradlinig und dünn war der Nasenrücken, der vor allem die vielen Reliefs prägte. Sie hatte langgliedrige Finger. Und, so war das damals, sie war kahl geschoren, hatte eine Glatze, um sich vor Läusen zu schützen.
Für ihr Äußeres verwendet die erhabene Königin viel Zeit. Schönheit ist ihr wichtig. Bäder, Salben, Schminken gehören zu ihrem Alltag. Sie trägt bei offiziellen Anlässen die gewaltige hochhütige Krone. Sonst trägt sie schwarze Perücken. Ihr König verehrt sie als eine
außerordentlich schöne Frau. Sie verkörpert das neue Reich, stolz, selbstbewusst, charismatisch, majestätisch, erotisch.
Echnaton schmückt sein Reich mit ihr. Auf den Säulen, die den nördlichsten und den südlichsten der neuen Stadt Achet-Aton markieren, lässt er über sie schreiben, damit es alle wissen sollen: „Schön von Angesicht, Besitzerin des Glücks, ausgestattet mit der Gunst zu hören, deren Stimme einen erfreut, Königin der Anmut, erfüllt von Liebe, Beglückerin des Herrschers der beiden Länder.“
Diese Beglückerin des Herrschers hatte ursprünglich einen anderen Namen. Erst als Amenophis IV., der die neue Sonnenreligion des „Aton“ gründete und sich den Namen Echnaton gab, sie heiratet, heißt sie Nofretete, was in etwa bedeutet: „Die Schöne, die da kommt“. Genau genommen heißt sie in Verbindung mit Aton „die Schöne, die da kommt, ist die Schönheit des Aton“.
Sie ist die Sonnenkönigin gewesen, und jenseits der komplizierten Windungen der Sonnenreligion des Echnaton ist das heute die einfachste Vorstellung dieser Frau: Sonnenkönigin von Ägypten. Der Ausstellungsbereich im ersten Obergeschoss ist das ägyptische Herz des Museums. Hier liegen und stehen die Schätze aus Amarna. Die die in Kunst getriebenen Lichtfiguren einer kurzen Epoche der langen Geschichte des alten Ägypten leben nun wie in einem Schattenreich. Nofretete und ihr Gemahl Echnaton sind seine überragenden Protagonisten.
Sie verkörpern das Reich des Aton. Verehrt wird der Sonnengott Aton, dessen einziger Sohn auf Erden der Pharao ist. Das war damals eine Dynastie der Revolution, mit der die gesamte Beamtenkaste Ägyptens im neuen Staat entmachtet worden war. Es herrschten nur noch der
Gott Aton und sein Stellvertreter auf Erden, der Pharao Echnaton. Das war Im 14. vorchristlichen Jahrhundert geschehen. Doch das Sonnenkönigtum dauerte nicht lange. Nofretete überlebte wahrscheinlich ihren Mann – man weiß es nicht genau. Sie war vielleicht sogar seine Nachfolgerin, konnte aber die Macht im ägyptischen Reich nicht sichern.
In ihrem neuen Museumsreich sind Echnaton und Nofretete in verschiedenen Szenen zu entdecken. Sie verstanden sich als Popstars ihrer Zeit und verkörperten den von ihnen geschaffenen Religionskult. Bereits als Amenophis IV. den Thron in Karnack bestiegen hatte, steht ihm Nofretete zu Seite. Doch dann kommt es zum Bruch mit der alten Amun-Religion der vielen Götter. Nun wird Aton als Gott der Sonne der oberste Weltenlenker, der den Ägyptern die Pharaonenfamilie geschenkt hat. Echnaton und Nofretete bauen sich eine neue Hauptstadt, die Achet-Aton im Amarnatal, Sie haben sechs Töchter, deren Namen mit -aton zusammengesetzt sind. Familienszenen voller Frohsinn und Liebe werden in Stein gehauen,
und stets umhüllen die Strahlen Atons die neue Herrscherfamilie Ägyptens. Diese kurze Zeit der religiösen Erneuerung nennt man die Amarna-Epoche, und das neue Museum ist das
Schaufenster und Archiv ihrer Geschichte.
3
Die auffallend hohe Position, die Frauen in der gesellschaftlichen Hierarchie im alten Ägypten eingenommen haben, ist in der Amarna-Epoche noch gestiegen. Nofretete ziert alle Symbole der Pharaonenmacht. Die blaue hohe Krone auf der Büste im Museum scheint eigens für sie geschaffen worden zu sein, ein Symbol der Regentschaft. In Kriegsszenen taucht sie als Führerin auf, sogar kultische und religiöse Zeremonien leitet sie ohne ihren Mann. Man sieht sie auf einem eigenen Thron, den die Zeichen der Vereinigung der beiden Länder Ober- und Unterägypten zieren. Soviel Macht hatte es vorher nie für die Gemahlin eines Pharaos gegeben. Dokumente überliefern, dass die beiden sechzehn Regierungsjahre zusammen verbracht haben. Wer von beiden mächtiger war, hätte Nofretete vielleicht mit dem Anflug eines Lächelns beantwortet.
Was nach der offensichtlich glücklichen Herrscherzeit geschah, bleibt im Dunklen. Die Beamten betreten wieder die Bühne, die alte Religion wird wieder Staatsreligion, und alle Hinweise auf Echnaton und Nofretete mussten aus der Öffentlichkeit beseitigt werden. Selbst das Grab bleibt unbekannt, in dem die Sonnenkönigin bestattet wurde.
Thutmosis, ihr künsterlischer Erschaffer, durfte ihr näher als jeder andere ihrer vielen Verehrer kommen, ganz nah, so dass er die kleinen Fältchen ihrer Augen, die Schminke und Makeup so sorgfältig zu überspielen wussten, am Ende ihrer Herrschaft gegen 1340 v.Chr. erkennen konnte. Sie hatte ihm vertraut, ihre Nähe zu seinem größten Kunstwerk zu verwandeln, mit der er ihre Unsterblichkeit sichern sollte, die durch das Wüten der Gegenrevolution in Ägypten in Gefahr war.
Sie hatte Thutmosis den Atem eingehaucht, damit Atons Geist in die geschickten Hände und in die tiefste Seele dieses großen Künstlers fahre. Sie hatte ihm den Bergkristall für die Gestaltung des einen Auges in die warme Hand gelegt. Auf seine Frage, wo der zweite Kristall für das andere Auge bleibe, hatte sie ihm geantwortet: Du schaffst die Schönste für die Zeit dieser Welt. Mit diesem einen Auge bleibe ich, was ich hier gewesen bin. Aber wisse, mein Freund, wenn diese Schönheit auf Erden bleibt, geht die vollkommen Schöne in Atons Reich ein. Dort wird auch das andere Auge leuchten. Nimm dieses als Auge für die ewige Schönheit auf Erden. Mit mir nehme das andere Auge für die Liebe in aller Ewigkeit.
Thutmosis ist Bildhauer. Er ist der oberste Bildhauer der königlichen Familie in Achet-Aton. Er hat Dutzende der herrlichsten Büsten und Reliefs der Aton-Erwählten geschaffen. Und er weiß, diese Nofretete wird sein Meisterwerk. Mit diesem Werk wird er selbst einen Teil ihrer Unsterblichkeit gewinnen. Wie in Trance hat er Tag und Nacht an der Büste gearbeitet, hat auf das Genaueste Berechnungen zu den Symmetrien angestellt, hat hart an den Details gearbeitet, wo er sich sonst aufs Gefühl verlassen hat, weiß sich unter der ständigen Beobachtung und Inspiration seiner großen Königin, wenn er mit spitzen Nadeln den harten
Kalkstein formt und mit seinen Fingern die dünnen Stuckschichten darüber ebnet.
Wie von ihrem Geist besessen arbeitet er Tag und Nacht an seiner Verehrten, hört die Ahnungen in sich und liest die Zeichen der Zeit, dass schon bald von ihr nichts auf Erden
bleiben wird als diese eine von ihm zu schaffende Gestalt. Fertig sind alle gehauenen, modellierten und geglätteten Arbeiten, perfekt und makellos ist das Werk. Die Augenhöhlen hat er auf ihr Geheiß im nackten Stein gelassen. Von der Königin hat er sich die kostbarsten Schätze ihrer an Farbsubstanzen so reichen Sammlung geben lassen. Er hat mit ihnen Experimente auf dem Stein und auf dem Gips gemacht.
4
Nun ist in der Werkstatt nur noch Stille und Konzentration. Seine Helfer hat er nach Hause
geschickt. Öllampen werfen ein weiches Licht. Alles liegt in seiner Hand. Vorsichtig stellt Thutmosis die zwanzig Kilogramm schwere Büste auf seinen Tisch in der Mitte der Werkstatt, gleichmäßig ausgeleuchtet von allen Seiten. Langsam und mit äußerster Vorsicht trägt er nun die Farben auf, schminkt seine Königin wie eine Geliebte. Als erstes malt er mit blau und weiß. Dann mischt er mit weiß auf blau. Als dritte Schicht verwendet er gelb. Dann kommt das Blau für ihre Krone und als Grundton für die herausgehobenen Teile des Gesichts. Am Ende und als fünfte Schichte färbt er das Rot über den Stein und den Gips. Den Bergkristall nimmt er, in den er eine feine Iris eingeritzt hat. Die Einlegstelle im rechten Auge hat er mit schwarzer Farbe unterlegt. An ihr befestigt er den Kristall mit Bienenwachs. Während der langen Arbeit hat er peinlich genau darauf geachtet, die linke leere Augenhöhle nicht zu berühren. Sie ist tabu für ihn und gehört einzig der Sonnenkönigin für ihre Reise außerhalb dieser Welt.
Als nun alles vollendet war, kommt die Königin in seine Werkstatt und sieht, dass alles gelungen ist. Da fragt Thutmosis seine Herrscherin: Wohin soll ich die Schönheit stellen, damit alle Menschen in ehrfürchtiger Bewunderung stehen bleiben, gebannt
von der Königin? Da überfällt das Gesicht der Nofretete tiefe Traurigkeit. Sie stellt sich hinter ihr Abbild und sagt: Sie werden mich nicht dulden und werden versuchen, alle Spuren meines Lebens zu vernichten. Doch wie Aton ewig ist, wird auch dieser Stein ewig sein. Verbirg ihn, dass kein Unheil ihn zerstören kann. Du wirst aus Liebe zu mir den Weg für meine irdische Unsterblichkeit finden.
Die Königin ist gegangen, und er wird sie nie wieder sehen. Thutmosis hat so viele Arbeiten in seiner Werkstatt. Er zweifelt nicht, dass seine Zeit bald vorbei sein wird. Ein Sturm wird ausbrechen, doch seiner kleinen Hütte wird nur die geringste Achtsamkeit gelten. Er bedenkt, wie Sturm und Sand über seine Werkstatt einbrechen werden, um die Wände und Regale mitsamt allen seinen Werken zu begraben. Er baut ein Brett auf halber Höhe der Wand, die sich schon jetzt ein wenig neigt. Darunter bereitete er wie ein Nest aus weichem Reisig ein Lager. Er berechnet den Sturz der Büste in der zusammenbrechenden Werkstatt und ist sicher, dass seiner Sonnenkönigin nichts geschehen kann, wenn sie vom Brett in die weiche Nestmulde fällt und dann von den Sandwogen zugedeckt werden wird. Er verneigt sich noch einmal vor ihr und verlässt seine Hütte, bevor die großen Verwüstungen beginnen.
Die dritte Grabung von Ludwig Borchardt im Tell-el-Amarna fand vom November 1912 bis zum März 1913 statt. Im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit stand ein bisher übersehener
kleiner Hügel, unter dem offensichtlich ein Haus gelegen haben musste. Der Hügel erhält die Markierung P 47,2. Borchardt findet heraus, dass es die Werkstatt des legendären
Bildhauers Thutmosis sein muss. Am 6. Dezember, Nikolaustag 1912, gelingt der Einstieg in den Raum 19 der Grabung. Dort findet Borchardt im Schummerlicht auf dem Boden im Sand liegend unversehrt die Büste der Nofretete.
Borchardt führt über die Grabungen gewissenhaft Protokoll. Ihm stockt der Atem, und
der erste Blick überwältigt ihn. Er reibt sich die Augen und notiert kurz: „Arbeit ganz hervorragend. Beschreiben nützt nichts, ansehen.“ Er findet sie in der Position 7, eine „lebensgroße bemalte Büste der Königin, 47 cm hoch.“
Finanziert wurden die Grabungen durch James Simon. Er hatte einen Vertrag mit der Orient-Gesellschaft abgeschlossen, nach dem er Besitzer aller Funde des deutschen Anteils der Grabungen werden solle. Die Regelungen in Ägypten sahen vor, dass eine Kommission, in der vor allem Engländer und Franzosen das Sagen hatten, die gefundenen Gegenstände zu
5
taxieren hatten, bevor sie zu gleichen Teilen der ägyptischen Altertumsverwaltung und dem Ausgräberland zugesprochen wurden.
Borchardts Geschick vor der Kommission bestand darin, den Wert der Büste runter zu reden und die anderen Funde, die er gemacht hatte, hoch zu jubeln. Tatsächlich kam es zur ordnungsgemäßen Teilung, und Nofretete konnte eingepackt und nach Deutschland verfrachtet werden. Der Streit um den rechtmäßigen Besitz, Ägypten oder Deutschland, begann mit ihrer Ausstellung 1924 im Neuen Museum. Der Streit hält politisch in diplomatisch immer neuen Gewändern bis heute an. Rechtlich ist die Lage eindeutig. Die Verhältnisse damals bestimmte allerdings die europäische Kolonialpolitik. Entführt oder ausgeführt: Die ägyptische Nofretete wurde Berlinerin. In ihre neue Gastbehausung ist sie erst spät gekommen und hat in ihrer neuen Zeit schon wieder viel erlebt.
II.
2250 Jahre ruhte die Schöne im Sand von Amarna, bevor sie 1913 nach Berlin reiste, wo sie für ein bewegtes Leben in immer neue Machtspiele verwickelt wurde. Erst am 16. Oktober 2009 bezog sie wieder ihren angestammten Sitz im Neuen Museum und schaut nun voller Selbstbewusstsein weit hinüber bis ans Ende der Bibliothek zum griechischen Sonnengott, der 1500 Jahre jünger ist als sie. Ins Museum kam sie 1913 noch lange nicht. Sie zierte zunächst die Villa von James Simon, die er im Tiergarten auf einem weiten Grundstück hatte, auf dem heute die Landesregierung von Baden-Württemberg residiert. Erst 1920 übergab er die Sonnenkönigin als Schenkung an den Freistaat Preußen für die Ägyptische Abteilung des Museums, wo sie allerdings erst ab 1924 öffentlich ausgestellt worden ist
Schnell wird die Schöne zum Idol der neuen Zeit in der Weimarer Republik nach dem verheerenden Krieg. Frauen eifern ihr mit Schminke und Makeup nach. Die Presse gewöhnt sich an, sie als die schönste Berlinerin zu titulieren. Berlin ist jedenfalls nach dem Sturz des Kaiserreichs entzückt von ihrer neuen Königin. Sie kommt gerade zur rechten Zeit in das Licht der Öffentlichkeit. So zart, so kühl, so schmal und ein wenig androgyn – das ideale Vorbild für die neue Mode.
Auch in den Theatern und in der Malerei steht sie Pate. Greta Garbo wird Nofreteteikone. Man hat eine ägyptische Königin, steinalt und doch jenseits von Raum und Zeit supermodern.
Die Herrschaft der neuen Königin dauert nicht lange. Schon zu Beginn des zerstörerischen zweiten großen Kriegs des Jahrhunderts verschwindet sie in einer Kiste in den Tresor der Reichsbank am Gendarmenmarkt. 1941 wird es auch dort zu heiß, und die Kiste wird in einen Flakbunker am Zoo gebracht. Im März 1945 wandert sie dann tief in den Salzstollen im thüringischen Merkers. Da holen sie die Amerikaner bereits nach zwei Wochen wieder raus und schleppen die Kiste in die Reichsbank nach Frankfurt. Die Kiste hat nun die Aufschrift „Die bunte Königin.“
So kommt sie als bunte Königin in die Kunstsammelstelle, die in Wiesbaden von der US-Armee eingerichtet worden war. Dem Kunstschutz-Offizier Walter Farmer ist es zu verdanken, dass sie nicht die Fahrt über den Ozean in die Vereinigten Staaten antreten
muss. Stattdessen schickt sie der Amerikaner Farmer ins Landesmuseum Wiesbaden. Erst im Juni 1956 darf sie ihre Heimreise nach Berlin antreten, ein Triumphzug. In den Osten auf die alte Museumsinselsoll kann sie nicht ziehen. Sie findet einen Platz in der Gemäldegalerie in Dahlem, die damals noch an der Fabeckstraße in Dahlem residierte.
6
Im Oktober 1967 wird das Ägyptische Museum in Charlottenburg mit den westlichen Restbeständen des ehemaligen Neuen Museums eröffnet, nun wieder mit Nofretete in der Mitte. 1992 kommt die alte Schöne in die Klinik zur Generalüberholung, danach geht es wieder zurück nach Charlottenburg. Ein paar Tage ist sie dann 2005 Star der Ausstellung Hieroglyphen um Nofretete im Kulturforum hinter dem Potsdamer Platz. Auch ein kurzes Gastspiel im Alten Museum darf die Sonnengöttin noch absolvieren, bis sich endlich der Reigen wieder schließt und sie mit neuer Kraft ihren alten ruhigen Platz der Zeitlosigkeit im Neuen Museum einnehmen darf.
Die Geschichte als Vergangenheit birgt eine Unendlichkeit an Beziehungen zwischen Orient und Okzident. Über solche Spielereien der Gedanken mit Blick auf die Menschen in ihrem Gesichtsfeld mag die Sonnenkönigin nicht einmal müde lächeln. Kopf und Hals hat sie nicht nach vorne geneigt, um dem Raunen und Flüstern ihrer vielen Verehrer zu lauschen. Diese Haltung der Zuwendung ist vielmehr der Tribut an die Ewigkeit, mit der sie, die perfekt symmetrisch erschaffene Kunstfrau, Gewicht und Ausdruck statisch am Leichtesten erhalten kann.
Für diese Statik ist sie ihrem Schöpfer immer wieder dankbar. Wie hätte sie sonst die Jahrhunderte im Sand überleben können, wie die strapaziösen Reisen, ihre Versenkung in Kisten und ihre stets neuen Sockelbetten und Audienzen bewältigen sollen? Nein, ihrem Thutmosis bleibt sie ewig und immer aufs Neue dankbar. Er hatte verstanden, was Echnaton meinte, als er sie die Beglückerin des Herrschers nannte und schön von Angesicht.
III.
1913 hat es in der Museumsgeschichte einen spektakulären Fall gegeben. Vierhundert Jahre ist das 77 mal 53 Zentimeter große Bild alt, das als das größte Museumswerk aller Zeiten bis Dezember 1911 im Pariser Louvre zu besichtigen war, die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Es wurde geklaut, war plötzlich verschwunden.
Jede Spur von Mona Lisa oder ihrem Dieb fehlte. Der dreiste Einbruch schien perfekt gelaufen zu sein. Im Herbst 1913 spitzte sich die fieberhafte Suche zu, und die Zeitungen waren voller Spekulationen über das Räuberstück. In dieser hektischen und nervösen Vorkriegszeit tauchte der spektakuläre Fall der Nofretete fast unter. Von der Königin in Ägypten redete kaum jemand, als im Dezember 1913 in Florenz ein Brief auftauchte. In ihm meldete sich der neue Besitzer mit der Bemerkung, das Bild gehöre nach Italien, da es von einem Italiener geschaffen worden sei. Er wolle diese Mona Lisa seinem Land wieder zurückgeben.
Der Mann suchte Kontakte, und bald flog die ganze Geschichte auf. Sie war die Tat eines glühenden Nationalisten. Im italienischen Parlament kam es zu opernreifen Szenen, und erst am Ende des Monats überquerte Mona Lisa unbeschädigt die französische Grenze, um wieder im Louvre zu residieren.
Diese Aufregungen beherrschten die Öffentlichkeit gerade zu dem Zeitpunkt, als in Ägypten der spektakuläre Fund gemacht wurde. James Simon ist ein weitsichtiger Mann. Er weiß einzuschätzen, was die Bergung der Nofretete bedeuten kann. Er hat ein Gespür für die heraufziehenden Muskelspiele der europäischen Großmächte, die geradewegs in den Krieg führen, auch in den Orient. Eingedenk der Verwicklungen, die der Fall der Mona Lisa nach sich gezogen hat, hält er es für angebracht, die Nofretete nicht in das grelle Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken. Das, so glaubt er, gelingt am besten, wenn er die
7
Büste auf seinen häuslichen Schreibtisch stellt. Keiner soll lauthals die Frage stellen, wie die schöne Königin nach Berlin kommen konnte. „Beschreiben nützt nichts, ansehen“, hatte Borchardt ausgerufen. Simons Wohnung ist ihr bestes Versteck.
Ab Januar 1914 steht sie nun da und verbirgt sich unter dem Kanonendonner des Krieges. Borchardt hatte gewarnt, die Verhandlungen über die Aufteilung der Schätze in Ägypten seien derartig schwierig geworden, „dass jede überflüssige Demonstration von Funden schädlich wirken kann.“
Der Kaiser schwärmt zwar über diese Kostbarkeit. Am liebsten hätte Seine Majestät die Königin an seiner Seite. Doch er erhält 1913 nur eine Kopie und kümmert sich im Übrigen lieber um das Säbelrasseln gegen Frankreich. Der 1. Weltkrieg kommt, und es wird still um die Nofretete im Haus von James Simon. Mit Grabungen in Ägypten ist für die Deutschen Schluss, und nach dem Krieg gibt es andere Sorgen.
James Simon schenkt 1920 seine große Renaissancesammlung und alle Amarnaschätze dem preußischen Staat in der neuen deutschen Republik. Wenige Jahre später ist dieser große Mäzen und ebenso große Menschenfreund, der riesige Geldbeträge für soziale Projekte gespendet hat, ein armer Mann. In der großen Inflation von 1923 hat er jeden Besitz verloren. Die Liebe seiner Königin ist ihm geblieben.